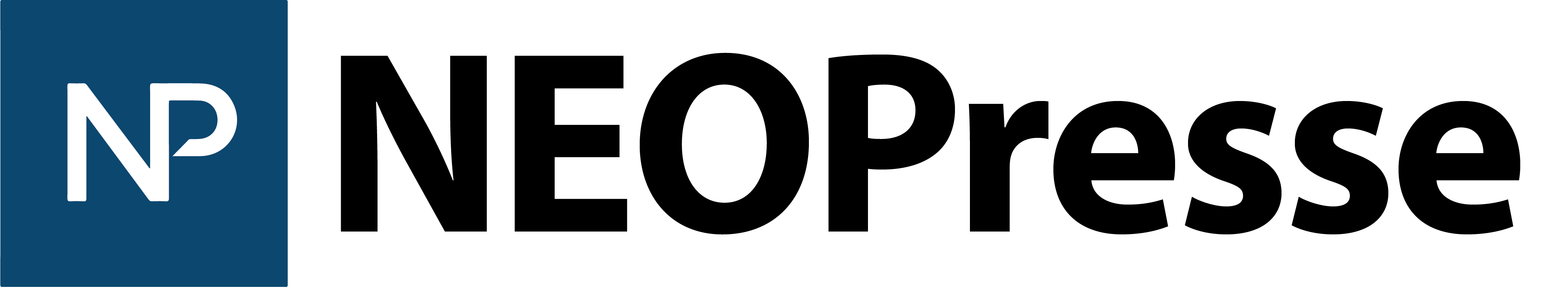Inmitten tiefgreifender Umbrüche in der Automobilbranche zeichnet sich eine ungewöhnliche Allianz ab: Der Rüstungsgigant Rheinmetall prüft, Teile seiner Militärproduktion in das Volkswagen-Werk im niedersächsischen Osnabrück zu verlagern. Hintergrund ist ein hochrangiges Treffen zwischen Rheinmetall-Chef Armin Papperger, MAN-CEO Alexander Vlaskamp und VW-Konzernvorstand Gunnar Kilian, das möglicherweise den Grundstein für eine strategische Partnerschaft legt. Das Ziel: die Kapazitäten des VW-Standorts für die Herstellung von Rüstungsgütern nutzen – ein Vorhaben, das nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch politisch brisant ist.
VW kämpft mit sinkenden Margen
Das Osnabrücker Werk, einst Symbol deutscher Cabrio-Tradition durch Marken wie Karmann, steht am Scheideweg. Aktuell produzieren die rund 2.300 Mitarbeiter hier noch das T-Roc Cabrio und die Porsche-Modelle Boxster und Cayman. Doch spätestens Mitte 2027 droht das Aus für die Cabrio-Fertigung – ein Schicksal, das viele traditionelle Automobilstandorte teilen. Die Kooperation mit Rheinmetall könnte daher nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern auch eine Brücke zwischen zwei Welten schlagen: der schrumpfenden Autoindustrie und der boomenden Rüstungswirtschaft.
Die Logik hinter dem Vorstoß ist eindeutig. Während VW mit den Folgen des Elektroumbaus, Lieferkettenproblemen und sinkenden Margen kämpft, profitiert Rheinmetall von der globalen Aufrüstungswelle. Das Joint Venture Rheinmetall MAN Military Vehicles, seit 2010 etabliert, könnte durch die Nutzung der Osnabrücker Infrastruktur schneller skalieren – insbesondere bei der Produktion militärischer Spezialfahrzeuge. VW-Chef Oliver Blume hatte zuletzt deutlich gemacht, dass der Konzern seine Rolle in der Sicherheitspolitik neu definieren müsse. „Wir tragen Verantwortung für die Resilienz Deutschlands“, betonte er – ein Signal, das in Berlin auf offene Ohren stoßen dürfte.
Doch die Hürden sind beträchtlich. Rheinmetall-Chef Papperger warnte bereits vor den Kosten einer Umrüstung: Die Produktionsanlagen in Osnabrück sind auf zivile Fahrzeuge ausgelegt, eine Anpassung an militärische Standards erfordert massive Investitionen. Zudem stellt sich die Frage, ob die Belegschaft – geprägt von einer jahrzehntelangen PKW-Kultur – ohne Widerstand auf Rüstungsaufträge umschwenken würde.
Politisch brisant ist der Vorstoß dennoch. Die Ampel-Regierung drängt auf eine Stärkung der Verteidigungsindustrie, gleichzeitig kämpft sie um den Erhalt industrieller Kerne in strukturschwachen Regionen. Eine erfolgreiche Kooperation in Osnabrück könnte zum Blaupause für andere Standorte werden – etwa für Werke, die durch den Verbrenner-Ausstieg gefährdet sind.
Historisch betrachtet markiert die Diskussion eine Zeitenwende. Dass ausgerechnet ein traditionsreicher Automobilstandort wie Osnabrück, der 2009 nach der Karmann-Insolvenz von VW übernommen wurde, nun zum Labor für Rüstungskooperationen werden könnte, unterstreicht den Druck auf die Branche. Es geht nicht mehr nur um Klimaziele oder Technologieführerschaft, sondern zunehmend um geopolitische Relevanz.
Ob das Projekt Realität wird, hängt von drei Faktoren ab: der Bereitschaft VWs, in Rüstungskapazitäten zu investieren, der finanziellen Unterstützung durch den Bund – und nicht zuletzt davon, ob Rheinmetall die komplexe Logistik einer hybriden Produktion stemmen kann. Sicher ist: Sollte die Kooperation gelingen, wäre sie mehr als ein betriebswirtschaftliches Experiment. Sie wäre ein Symbol für den Wandel der deutschen Industrie in einer Ära der Krisen.