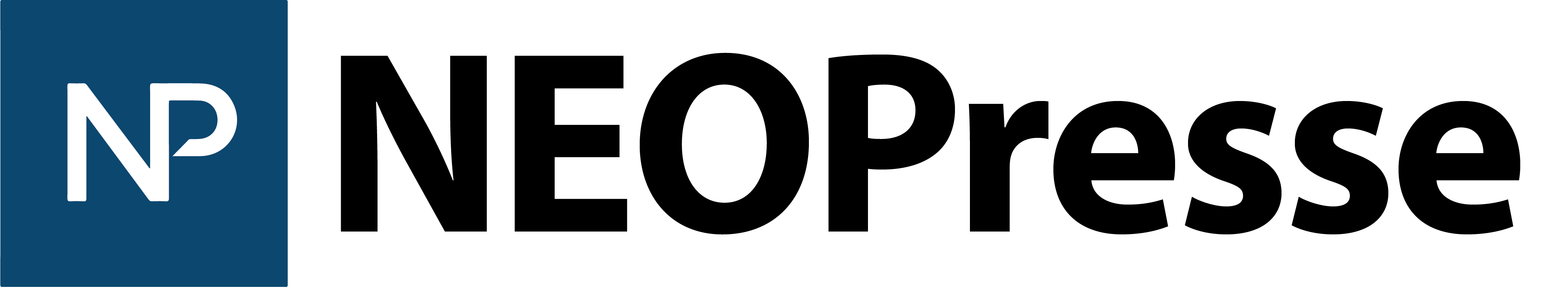Die EU möchte seit dem 1. Oktober per sogenanntem CO-2-Grenzausgleich die CO-2-Emission von Nicht-EU-Ländern bestrafen – in dem Sinn, dass die energieintensive Industrie in der EU geschützt werden soll. Diese Industrie muss Zertifikate kaufen, um die CO-2-Emissionen zu regulieren und so zu verteilen, dass der Meistbietende letztlich zum Zuge kommt – in der Vorstellung, dass damit auch die beste Verwendung provoziert wird. Die afrikanischen Länder nun wehren sich gegen diese Art von Schutz.
Abgaben für afrikanische Lieferanten?
Es liegt praktisch nahe, dass die Afrikaner sich dagegen schützen müssen, weil ihnen neue Abgaben auferlegt werden, die wiederum in der EU die Industrie schützen sollen. Der entsprechende Mechanismus nennt sich „Carbon Border Adjustment Mechanism, abgekürzt CBAM). Bis dato gilt dieser Mechanismus dem Bericht nach als „Probelauf“. Grundstoffe, dies sind Aluminium oder Eisen, seien betroffen.
Afrikanische Staaten seien von diesen Maßnahmen sehr stark betroffen, heißt es. Dies reicht in die Kolonialzeit zurück. Damals haben die Kolonialherren afrikanische Länder tatsächlich auf die Rolle als Rohstofflieferanten festgelegt. Als Beispiel dient hier Mosambik. Das Land rechnet ohnehin zu den ärmsten weltweit. Immerhin gut 25 % der Erlöse aus dem Export von Waren und Dienstleistungen bezieht das Land aus den Exporten von Aluminium in die EU. Damit würde das Abkommen oder der Mechanismus CBAM teuer: Bis zu 2,5 % der Wirtschaftsleistung des Landes stünden hier auf dem Spiel. Armut sowie Arbeitslosigkeit wären die Folge, so die Beschreibung.
Ob die EU sich nun bewusst über diese Rechnungen hinweggesetzt hat oder sich quasi als Kolonialherrin aufspielt, ist offen. Wenn es tatsächlich nur um die Reduktion von CO-2 oder zusätzliche Abgaben geht, ist zumindest dieser Verweis aus Afrika sicherlich nachvollziehbar.