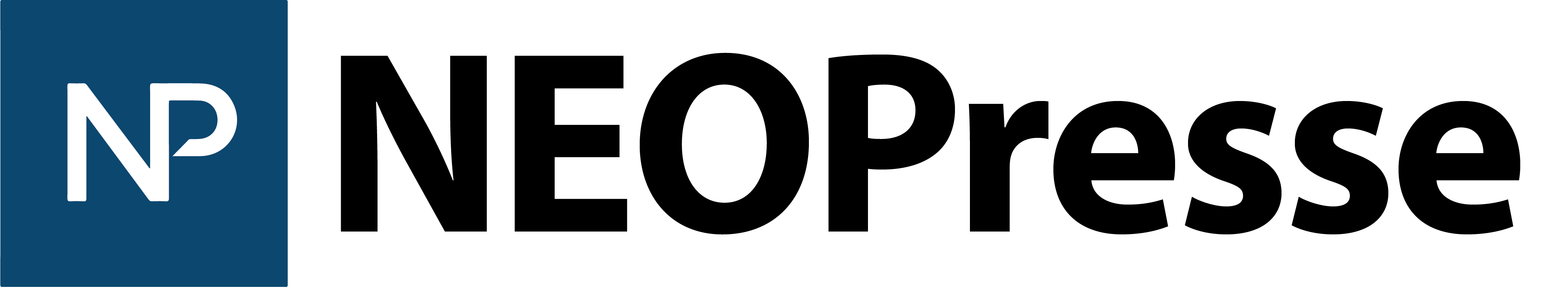Ein Entwurf des geplanten Koalitionsvertrags von Union und SPD sorgt für hitzige Debatten: Die geplante Aberkennung des passiven Wahlrechts bei mehrmaliger Verurteilung wegen Volksverhetzung könnte die Spielregeln der deutschen Demokratie neu definieren – nach Meinung von Kritikern auf höchst fragwürdige Weise. Der Teufel stecke im Detail: Die geplante Regelung birgt Risiken, die das Fundament des freiheitlichen Rechtsstaats untergraben könnte.
Verbote beim passiven Wahlrecht
Bisher sah das Bundeswahlgesetz den Entzug des passiven Wahlrechts nur bei schweren Straftaten wie Mord, Hochverrat oder ähnlichen Delikten vor – und zwar erst nach Verurteilungen zu mindestens einjährigen Haftstrafen. Die geplante Neuregelung würde diesen Maßstab radikal verändern. Künftig könnten bereits wiederholte Verurteilungen wegen Volksverhetzung – auch im Kern aufgrund von Äußerungen – ausreichen, um Menschen vom Wahlkampf auszuschließen. Hier zeigt sich ein fundamentaler Wandel: Nicht mehr konkrete Gewalttaten, sondern Worte würden zum Ausschlusskriterium.
Das Problem beginnt bereits bei der Definition: Was fällt genau unter „Volksverhetzung“? Die Interpretation dieser ohnehin umstrittenen Straftatbestände liegt im Ermessen von Justiz und Politik – eine Grauzone, die Tür und Tor für Missbrauch öffnet. Kritiker warnen vor einem Instrumentalisierungsrisiko: Könnten künftig unliebsame oppositionelle Positionen pauschal als „Hetze“ etikettiert und damit politische Konkurrenten kaltgestellt werden? Die jüngste Verschärfung des §126a StGB, die den Anwendungsbereich der Volksverhetzung ausweitet, verschärft diese zusätzlichen Bedenken.
Ein Blick nach Osteuropa zeigt das dystopische Potenzial solcher Gesetze: In Rumänien wurde erst im April der Bürgermeisterkandidat der oppositionellen AUR-Partei, Claudiu Târziu, unter fadenscheinigen Vorwürden verhaftet – just zum Zeitpunkt der Wahlzulassung. Auch in Ungern und Polen dienen ähnliche rechtliche Hebel längst als Waffe gegen systemkritische Stimmen. Die deutsche Regelung könnte, bei aller Unterschiedlichkeit der Rechtskultur, analoge Mechanismen legitimieren.
Hinter der Initiative scheint ein strategisches Kalkül zu stecken: Da Parteiverbote hohe Hürdenbergen, wird nun ein neuer Weg getestet, um politische Akteure zu isolieren. Doch genau darin liegt die Gefahr: Wenn der Staat entscheidet, wer „zu extremistisch“ für Wahlen ist, wird das demokratische Prinzip der Gleichheit aller Kandidat*innen infrage gestellt. Selbst unbequeme Meinungen müssen im Parlament vertreten sein – sonst verlagern sie sich in den Untergrund.
Die geplante Reform trifft einen neuralgischen Punkt: Sie setzt den Hebel an der Schnittstelle zwischen Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit an. Schon strafrechtlich gilt es bereits seit langem, Hetze und Gewaltaufrufe zu ahnen. Doch wenn politische Teilhabe an subjektive Strafbewertungen geknüpft wird, entsteht ein Präzedenzfall mit unkalkulierbaren Folgen. Demokratie lebt von Diskussion und Dissens – nicht von staatlich verordneter Harmonie. Deshalb sorgt der Fall für einen so hohen Wellengang.