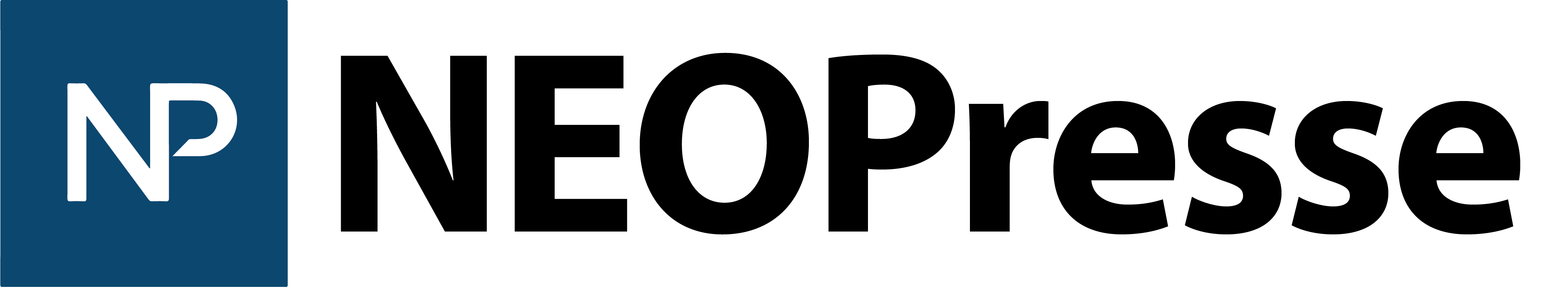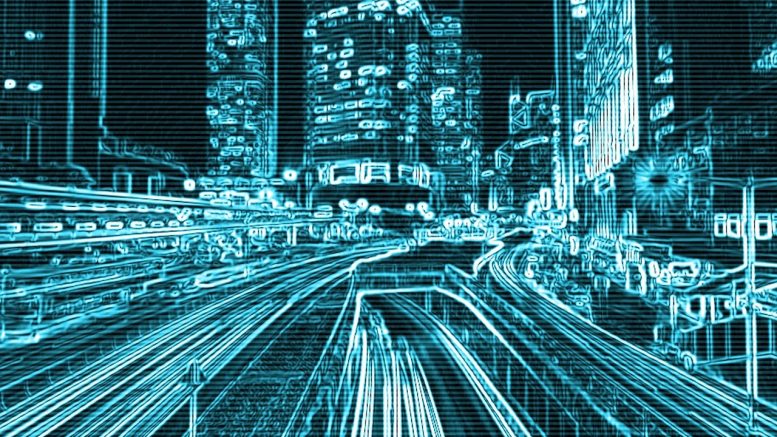Liebe Leser,
in der zweiten Hälfte des Januars wurden die grundlegenden Ansichten der Anleger gründlich aufgewirbelt und infrage gestellt. Das hatte auch für die Unternehmen aus dem Rohstoffbereich und ihre Börsenkurse, besonders jene aus dem Kupfer- und Uransektor, eine hohe Bedeutung, denn sie hatten vom Boom der KI-Anwendungen und der von ihm ausgehenden höheren Nachfrage in der Vergangenheit stark profitiert.
Zunächst folgte die Entwicklung dem bisherigen Trend und dieser besagte, dass in Zukunft mehr KI-Anwendungen das Bild bestimmen werden. Sie benötigen – da waren sich die Anleger in der ersten Hälfte des Januars noch vollkommen sicher – mehr Strom. Aus dem höheren Strombedarf hatten die Marktteilnehmer schon im vergangenen Jahr einen höheren Bedarf an Uran und Kupfer abgeleitet.
Der für die neuen KI-Anwendungen nötige Strom muss irgendwie erzeugt werden und an dieser Stelle ist man sich gerade in den USA einig, dass der Weg nur über neue Atomkraftwerke führen kann. Egal, ob sie als klassische Meiler oder in Form der modernen kleineren modularen Reaktoren (SMR) gefertigt werden, der Bedarf an Uran stand für die Anleger außer Frage.
Auch am Kupfer führte nach Ansicht der meisten Investoren kein Weg vorbei, denn für die Umsetzung der KI-Anwendungen waren nicht nur immer größere Rechenzentren eingeplant worden, sondern man ging auch davon aus, dass diese Rechenzentren untereinander ebenfalls vernetzt werden müssten und dafür schien das Kupfer das Mittel der Wahl zu sein.
Der Überbietungswettbewerb der KI-Anbieter
Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Erwartungen startete Mitte Januar die nächste mediale Schlacht um die führende Stellung im KI-Bereich. Schon in den ersten Tagen des neuen Jahres hatte Microsoft verkündet, dass es im Jahr 2025 insgesamt 80 Milliarden US-Dollar für seine KI-Rechenzentren ausgeben werde.
Wenige Tage nach seiner Amtseinführung ließ auch US-Präsident Donald Trump sich nicht lumpen und kündigte mit dem Stargate-Projekt für den Zeitraum der nächsten vier Jahre die Investition von 500 Milliarden US-Dollar in den KI-Sektor an. Er machte den KI-Boom damit quasi zur Chefsache.
Aus der Sorge heraus, in diesem Wettrennen möglicherweise als zaudernder Nachzügler wahrgenommen zu werden, kündigte Meta anschließend eigene Investitionen von 60 bis 65 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung seines KI-Sektors an. Wobei betont wurde, dass ein großer Teil dieser Summe für den Bau und die Unterhaltung eines 2-GW-Rechenzentrums ausgegeben werden soll.
DeepSeek stört die Party gewaltig
Die Weichen für ein ungestörtes Weiterfeiern der KI-Party an den Börsen dieser Welt schienen damit gestellt. Doch wie so oft kam es anders als die Masse der Anleger es erwartet hatte. DeepSeek veröffentlichte seine Studien und legte dar, dass es für die Weiterentwicklung seiner KI-Software weitaus weniger Hochleistungschips benötigt hatte als die Wettbewerber aus dem Westen.
Seitdem stehen alle bisherigen Annahmen über die Intensität der Chipnutzung, den Stromverbrauch und die erforderlichen Kapitalinvestitionen für neue KI-Anwendungen zur Disposition und die Anleger fragen sich, welchen Zahlen sie noch trauen und welche Annahmen sie bei ihren verschiedenen Studien wirklich zugrundelegen sollen.
Klar ist, dass insbesondere jene Studien, die im Rausch des KI-Booms und der Rallye an den Aktienmärkten entstanden sind, nicht nur im Grundton zu optimistisch ausgefallen sein dürften, denn es deutet sich an, dass der Aufbau neuer KI-Kapazitäten deutlich weniger Rechenleistung erfordern wird als noch vor wenigen Wochen erwartet wurde. Das senkt auch die Nachfrage nach Kupfer und Uran.