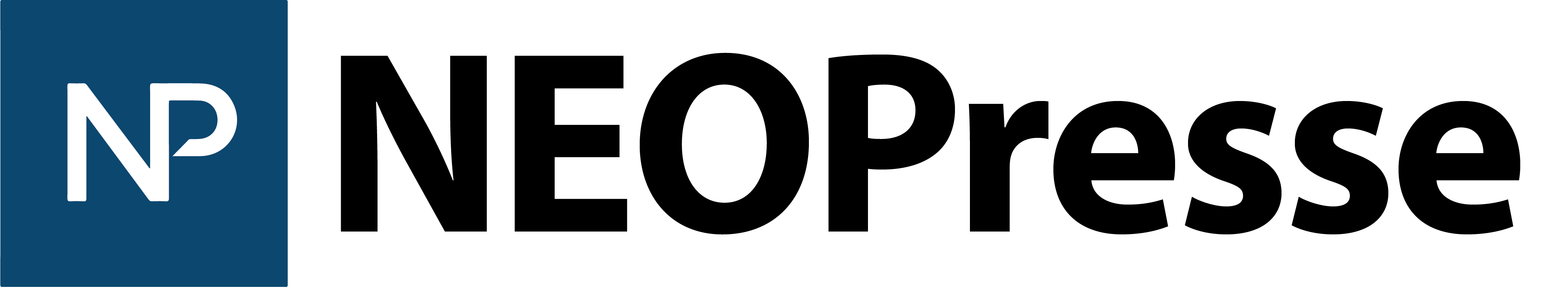Hand aufs Herz: „Wann haben Sie den letzten Jubelartikel über die hohe Solar- und Windstromproduktion in Deutschland gelesen? Der Zeitpunkt dürfte vermutlich einige Monate zurückliegen, denn für derartige Beiträge sind die Monate Juni und Juli prädestiniert. Bis zum 21. Juni werden die Tage immer länger und die Zeit, um mit Solaranlagen Strom zu erzeugen, wird es damit auch.
Deshalb können die Monate Mai und Juni mit schöner Regelmäßigkeit für sich in Anspruch nehmen, einen besonders hohen Anteil an der Erzeugung von Ökostrom zu haben. In den Wintermonaten kehrt sich diese Entwicklung jedoch um. Das hört sich im ersten Augenblick harmloser an als es tatsächlich ist, denn im laufenden November, waren Tage mit viel oder wenigstens etwas Sonne selten.
Das wäre ja noch zu verkraften, wenn wenigstens der Wind konstant in einer ausreichenden Stärke wehen würde. Aber auch hier wurden wir von Mutter Natur eher enttäuscht als beglückt, denn der November war vergleichsweise windstill. Schlechtere Voraussetzung für die 30.243 deutschen Windräder an Land, die 1.602 Offshore-Windräder und die 3,7 Millionen Solaranlagen im Land hätte es kaum geben können.
Ohne Hilfe aus dem Ausland wären in Deutschland im November 2024 die Lichter ausgegangen
Es versteht sich von selbst, dass selbst eine Verdoppelung oder Verdreifachung der installierten Leistung nicht ausreichen würde, um die entstandene Unterversorgung zu beseitigen, denn ohne Sonne und Wind hätten auch diese zusätzlichen Anlagen ihre Produktion sofort weitgehend eingestellt.
Die Folge wäre ein großflächiger Blackout gewesen. Er konnte nur verhindert werden, weil die noch im Land vorhandenen Kohlekraftwerke, die Bundesklimaminister Robert Habeck nicht vorsorglich hatte sprengen lassen, ihren Betrieb wieder aufnahmen. Doch auch ihre Leistung reichte nicht aus, um die Lücke zwischen Angebot und Bedarf zu schließen.
Dies gelang nur mit Stromimporten aus dem Ausland. Diese hatten allerdings ihren Preis. An der Strombörse in Leipzig hatte der Durchschnittspreis auf Tagesbasis für eine Megawattstunde im späten Oktober noch zwischen 60 und 100 Euro gelegen. In der ersten Novemberhälfte verteuerte sich die Megawattstunde jedoch spürbar auf 120 bis 140 Euro, wobei der tiefste Tagesdurchschnittspreis am 1. November, einem Feiertag in vielen Bundesländern, mit knapp unter 80 Euro und der Höchstwert am 6. November mit 230 Euro erreicht wurde.
Was das für Sie persönlich bedeutet, dürfte Ihnen Ihr Stromanbieter spätestens bei der nächsten Abrechnung auf den Cent genau vorrechnen. Freuen dürfen Sie sich derweil schon einmal auf die nächsten Monate, denn dann werden auch die enormen Kosten für den Netzausbau, die es ohne die verfehlte Energiewende in der Höhe nie gegeben hätte, auf die Stromkunden abgewälzt.