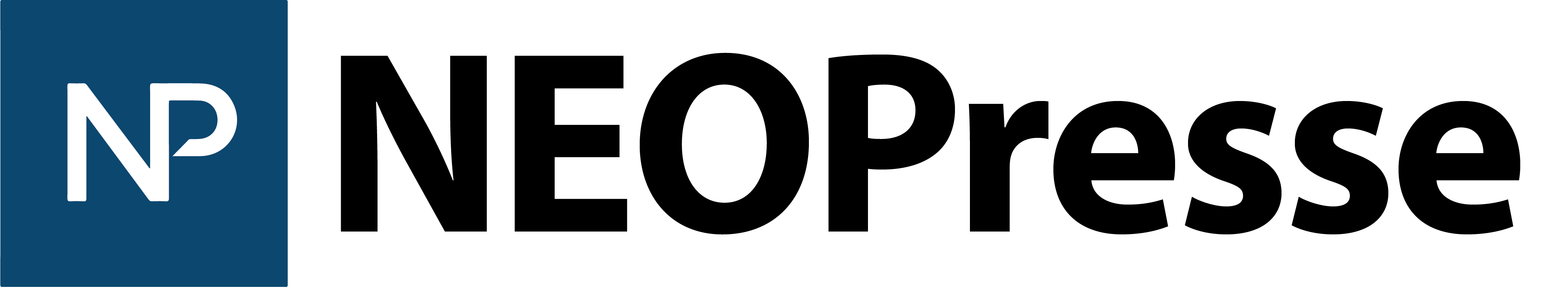Viel Aufregung um Karl Lauterbach und die „Protokolle“. Ein Teil der Schwärzungen von Corona-Protokollen des sogenannten Expertenrats ist nun entschwärzt worden. Was aber meint nun der Vorgänger von Karl Lauterbach als Gesundheitsminister zur gesamten Ausarbeitung?
Spahn möchte eine „Aufarbeitung der Corona-Politik“, die der Bundestag vornehmen solle. Die aber sollte „breit angelegt“ sein. Dies sollte weder durch die „rosa-rote Brille für die damalige Bundesregierung“ sein, aber auch kein „Volksgerichtshof der Corona-Leugner“. Harter Tobak.
Harter Tobak durch Jens Spahn?
Immerhin würden 70 % bis 80 % der Deutschen die Corona-Politik bis zum Ende der Pandemie unterstützt oder „mitgetragen“. „Deswegen müssen sich schon auch alle Blickwinkel dort wiederfinden“. Es ginge um eine „Aufarbeitung, um zu lernen“ und sich besser auf eine andere Krise vorzubereiten, so Spahn.
Kritiker sehen dies anders – und tatsächlich auch persönliche Verantwortlichkeiten. So ist etwa die Rolle von Karl Lauterbach zu untersuchen, wie berichtet – über die Corona-Protokolle des sogenannten Expertenrates.
„Ein Detail ist „bemerkenswert“: So hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dem Corona-Expertenrat damals vorgeschlagen, Ungeimpfte sollten den Zutritt zu Läden für den täglichen Bedarf und zu Restaurants auch dann verlieren, wenn sie den Genesenen-Status hätten. Das wäre die Variante „G1“.
Damals galten Genesene als immun gegen weitere Ansteckungen – für eine bestimmte Zeit jedenfalls. Sie waren Geimpften gleichgesetzt. Der Vorschlag ist damals nicht in die Tat umgesetzt worden, hätte aber das gesellschaftliche Leben mit dieser harten Variante weiter eingeschränkt. Die Idee ist im Wortsinne radikal.
Das ganze Aktien-Sonderdossier: Stand 11.04. – gratis herunterladen!
Lauterbach wollte das Impfen demnach gegen jede wissenschaftliche Expertise, auf die er sich berief, weiter ausdehnen.
In einer anderen Frage steht seine Mitarbeit aktuell noch aus. Die „StopptCovid-Studie“ ist noch immer nicht veröffentlicht:
„Der Geduldsfaden mit Karl Lauterbach ist in einem Punkt im Kanzleramt gerissen. Der Gesundheitsminister soll die bis dato unter Verschluss gehaltene Studie „StopptCovid-Studie“ aus dem RKI nun veröffentlichen. Diese Studie hat nichts mit den RKI-Protokollen zu tun, sondern ist als Bilanz der deutschen Corona-Politik entstanden.
Lauterbach hatte sie im Jahr 2023 vorgetragen (das RKI ist dabei eine nachgelagerte Behörde des Gesundheitsministeriums) und darauf verwiesen, von der Studie sehr gute Noten erhalten zu haben. Die Studie selbst sollte die Öffentlichkeit aber zunächst gar nicht zu Gesicht bekommen. Jüngst drängte dann FDP-Bundestagsvizepräsident Kubicki erneut zur Veröffentlichung. Das Kanzleramt verlangte als Reaktion darauf gleichfalls die Veröffentlichung und Lauterbach wollte „bis Ende 2024“ die Studie veröffentlichen. Bis Ende 2024? Als das Kanzleramt sich offenbar beschwerte – die Studie muss ja nicht einmal überarbeitet werden -, korrigierte Lauterbachs Ministerium: Das Ganze sei ein Missverständnis. Gemeint sei Ende März 2024.
Lauterbach: Leider falsch ausgedrückt
Das war die Kurzfassung des Krimis. Die Studie galt als „eine Art wissenschaftlicher Schlusspunkt unter die Pandemie“ und hätte als solche wahrscheinlich – eine subjektive Einschätzung – niemals den Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Im Kern ließ eine Behörde, das RKI, den übergeordneten Auftraggeber, das Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach, hochleben. Warum, weshalb, mit welchen Methoden, all das wäre verborgen geblieben.
Die Daten wie auch die Modelle sind schlicht nicht veröffentlicht worden, aber zitiert. Denn alle Aussagen können nur auf Modellen und Daten basieren, in einer komplexen Realität gibt es keine „Wahrheit“ in dem Sinn, dass eine Kennziffer, z. B. die Zahl der Todesopfer, im Nachhinein erklären hätte können, was falsch und was richtig war. Wenn man mit Daten und Modellen arbeitet, sollten diese dem wissenschaftlichen Verständnis nach aber aufgedeckt werden.
Dass dies nicht passierte, hat Kubicki recht deutlich an Lauterbachs demokratischem Verständnis zweifeln lassen. „Sie müssen nicht daran erinnert werden, dass das parlamentarische Auskunftsrecht nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes sehr weitreichend ist“. „Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind keine Bittsteller, sondern haben einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Informationen.“
Die Regierung will nicht, dass Sie das hier über die Aktien-Situation lesen:
- Die Koalition will es Verheimlichen – Gratis-Dossier!!
- Ihr Gratis-Report liegt hier bereit – Sie sind qualifiziert!
- Versand in 2 Klicks bestätigen – Das Aktien-Dossier Stand 11.04..